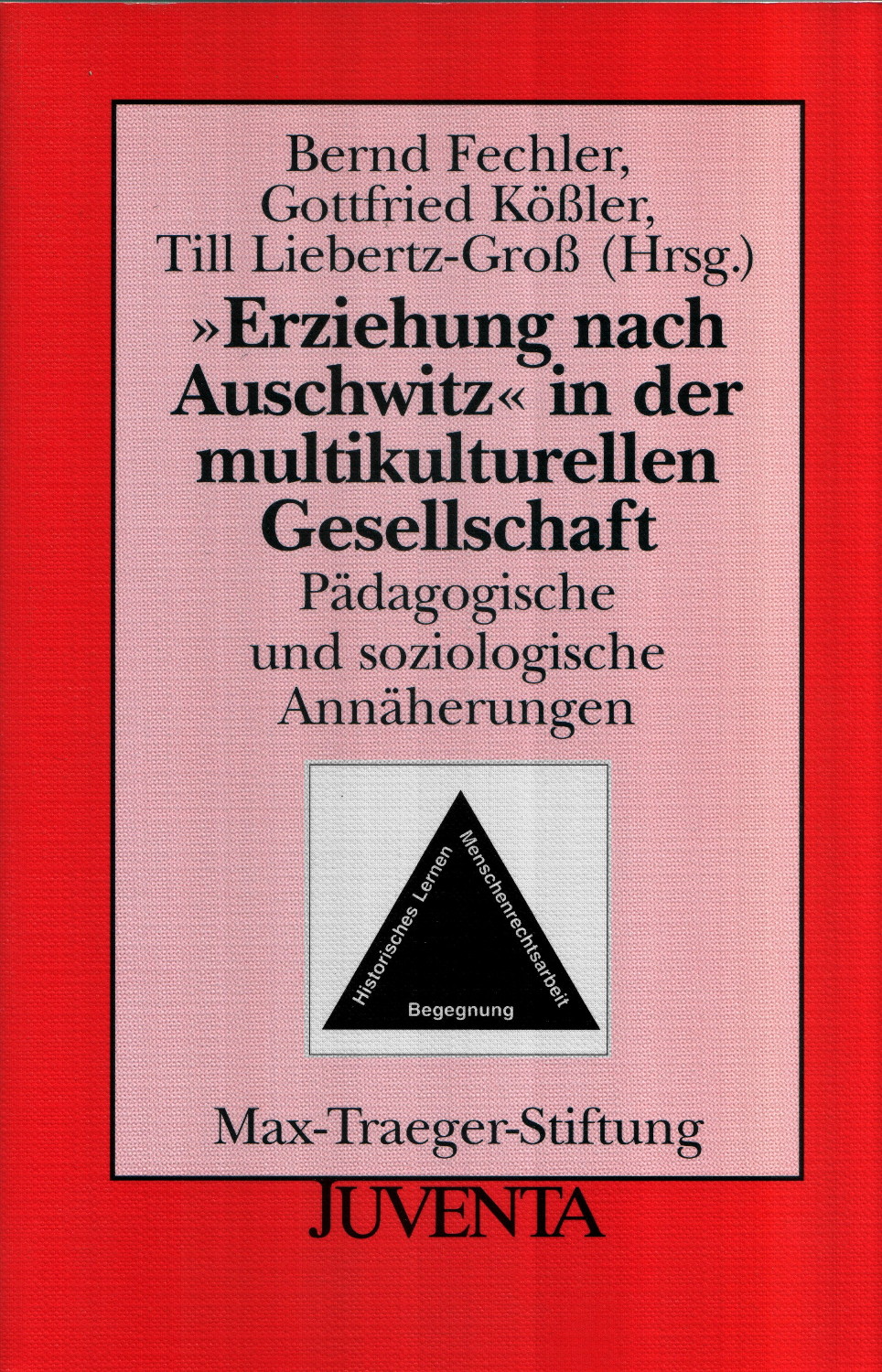Einwanderung und Traditionsbildung
Einwanderung und intergenerationelle Traditionsbildung
Günter Max Behrendt
Was mich die letzten drei Jahre beschäftigt hat, war die Frage der Bildung ethnischer communities — manchmal auch „ethnische Kolonien“ genannt. Konkret ging es darum, wie die türkischen communities in Hannover entstanden sind und was die türkischstämmigen HannoveranerInnen mit diesen ethnischen communities anfangen. Dazu gab es ein empirisches Forschungprojekt am Institut für Politische Wissenschaft der Universität Hannover und soweit hier Zahlen, Fakten und Interviews zitiert werden, stammen sie aus dem Projekt.[1]
Anfangs spielte das Generationen-Thema in dem bewußten Forschungsprojekt keine große Rolle. Es war die Auseinandersetzung mit unseren Gesprächpartnern, den Menschen, um die es in der Untersuchung ja letztlich geht, die uns die Beschäftigung mit dem Generationen-Thema förmlich aufgenötigt hat. Nun ist das Schöne an einem qualitativen Forschungsansatz, wie wir ihn befolgt haben, daß man solch einer ‚Nötigung‘ dann auch wirklich nachgehen kann. So kann ich hoffen, hier etwas beizutragen — wenn auch mit der notwendigen Einschränkung, daß das Folgende nur Gültigkeit für die Einwanderungsgruppe aus der Türkei beanspruchen kann.
Während der ersten Phase des Projektes, während der sog. „Expertengespräche“, stammten unsere Gesprächspartner fast ausschließlich aus der ersten Generation, und die redet viel über „die Jugend“. Speziell bei den Vertretern der türkischen Vereine, und davon gibt es über 50 in Hannover, stach diese eine Gemeinsamkeit heraus: Sie alle wollen „die Jugend retten“. Damit ist gemeint, daß sie die Generation ihrer Töchter und Söhne vor Drogen, Kriminalität und Sittenlosigkeit bewahren möchten. Unausgesprochen ist damit das Problem berührt, daß kaum einer der türkischen Vereine in Hannover in der Lage ist, diese nachwachsende Generation in das Vereinsleben einzubinden. Das hat viele Gründe, einige sind banal: Der Jugendfunktionär in der Milli Görüş-Moschee erzählte z.B., daß es ihn Jahre gekostet hat, den Vereinsvorstand davon zu überzeugen, daß es weder gottlos noch sittenwidrig ist, im Keller der Moschee eine Tischtennisplatte aufzustellen. Andere Ursachen sind schwerlich zu ändern: In Einrichtungen mit Teehaus-Charakter kann sich die jüngere Generation nicht ungezwungen benehmen, wenn die Elterngeneration den Raum dominiert, also bleiben die Jüngeren weg. Ein anderes Beispiel: Der erfolgreichste türkische Fußballverein Niedersachsens, Damla Genç, feierte vor zwei Jahren sein 20jähriges Jubiläum, doch eine Jugendmannschaft hat Damla Genç erst seit vier Jahren. Und zwar deshalb, weil vor vier Jahren der niedersächsische Fußballverband allen Vereinen in den höheren Ligen mit Zwangsabstieg drohte, wenn sie keine Jugendmannschaften aufstellten. Von den anderen türkischen Fußballvereinen in Hannover hat sonst nur noch „Karadeniz“ eine Jugendmannschaft.[2]
Natürlich gibt es zu jedem Trend Gegenbeispiele: Im Falle der fehlenden Attraktivität türkischer Vereine für Jugendliche ist das die erfolgreiche Jugendarbeit bei der türkischen Islamistenorganisation Milli Görüş und den aletivischen Kulturvereinen. Auf die Gründe hierfür weiter einzugehen, würde allerdings den Rahmen sprengen. Erst in der zweiten Projektphase, in welcher wir von den Expertengesprächen zu Tiefeninterviews übergingen, bekam ich es verstärkt mit Menschen der zweiten Generation zu tun. Und auch hier war das Verhältnis zur Elterngeneration ein gewichtiges Thema.
Hier möchte ich einen Einschub machen und der Frage nachgehen, was heißt das eigentlich, wenn man von der „Zweiten Generation“ spricht? Der Begriff wurde in der ersten Hälfte der 70er Jahre geprägt, als das deutsche Schulsystem sich plötzlich in großer Zahl mit den schulpflichtigen Kindern der seit den 60er Jahren eingewanderten ArbeiterInnen konfrontiert sah.[3] Der Begriff war also weitgehend identisch mit dem damals auch in der Wissenschaft gebräuchlichen Ausdruck „Gastarbeiterkinder“. Um dem Eiertanz um das Wort „Gastarbeiter“ ein Ende zu machen und nicht ständig von den „sog. Gastarbeitern“ in Anführungsstrichen zu sprechen, ersetze ich den Ausdruck für mich durch „Kontraktarbeiter“. „Kontraktarbeiter“ definiere ich als die Gruppe der zwischen 1961 und 1973 zugewanderten ArbeitsmigrantInnen, die unter dem Regime des staatlichen Anwerbeverfahrens ins Land kamen. Die Betroffenen selbst benutzen übrigens im Türkischen den Begriff „Kontrakt“ auch. Sie sagen von sich, sie seien „kontratlı“ — also mit Vertrag/Kontrakt — nach Deutschland gekommen. Sie betonen das u.a. deshalb so stark, weil sie sich dadurch absetzen können von den später Gekommenen, insbesondere den Asylbewerbern, mit denen sie zumeist nichts zu tun haben möchten. Das aber nur als Randbemerkung.
Da der Begriff „Zweite Generation“ für die Kinder dieser KontraktarbeiterInnen geprägt wurde, ist für den Alltagssprachgebrauch ganz klar, daß die KontraktarbeiterInnenselbst die „Erste Generation“ darstellen. Diese Gleichsetzung ist im Alltagsbewußtsein fest verankert. Sieht man aber einmal von dieser BRD-spezifischen, historischen Fixierung ab, so bedeutet „Migranten der Zweiten Generation“ zunächst nur, daß die Entscheidung zur Migration nicht von den Mitgliedern der fraglichen Generation, sondern von ihren Eltern getroffen wurde. Nicht sie, sondern ihre Eltern sind die „PioniermigrantInnen“ gewesen, hatten als erste einen Haushalt in der Aufnahmegesellschaft gegründet.[4] Hier kommt die US-amerikanische Forschung und das bekannte Konzept des race-relations-circle ins Spiel. Selbiges besagt in grober Skizze: Die erste Generation lernt die neue Sprache des Aufnahmelandes nur bedingt und bleibt lieber unter sich, die Folge sind Ghettos wie Chinatown oder Little Italy. Die zweite Generation dagegen paßt sich der Aufnahmegesellschaft stark an, distanziert sich kulturell von ihren Eltern, verweigert auch deren Sprache und Sitten. Der Kreis soll sich letztlich schließen mit dem ethnic revival in der dritten Generation, die trotz perfekter Beherrschung der Sprache der Mehrheitsgesellschaft die kulturellen Wurzeln der Großeltern wiederbelebt und z.B. bewußt die Muttersprache ihrer Großeltern pflegt. So verstanden, können die Begriffe erste, zweite oder dritte Generation immer nur im Hinblick auf konkrete Familien sinnvoll sein, unabhängig davon in welchem Jahrzehnt die Migration des ersten Mitglieds dieser Familien erfolgte. Auf die BRD bezogen heißt das, daß auch ein politischer Flüchtling, der, sagen wir nach dem Putsch von 1980 in der Türkei, allein und als erster seiner Herkunftsfamilie um Asyl in der BRD nachsuchte, für sich und seine später entstandene neue Familie eine „Erste Generation“ begründet. Lassen wir diesen Flüchtling 1985 heiraten und ein Jahr später ein Kind bekommen. Dieses Kind drückt heute als zwölfjährige Migrantin der zweiten Generation die Schulbank. Wenn aber ein anderes Elternpaar in den 60er Jahren als KontraktarbeiterInnen einwanderte und später seine — sagen wir 1958 geborene — Tochter nachholte, dann ist diese Migrantin der zweiten Generation heute 40 Jahre alt. Im Extremfall kann die familienorientierte Definition von „Zweiter Generation“ heute auf Säuglinge genauso zutreffen wie auf bald 50jährige Erwachsene. Lassen wir die heute 40jährige Tochter aus dem vorigen Beispiel ihrerseits ein zwölfjähriges Kind haben, dann könnte diese Migrantin der dritten Generation in die gleiche Schulklasse gehen wie das zuvor erwähnte zwölfjährige Kind der fiktiven Flüchtlingsfamilie. Türkischstämmige Einwanderer der zweite und dritten Generation können also ohne weiteres gleich alt sein. Man versucht, das auf den Begriff zu bringen mit der umständlichen Klammerschreibweise „Migranten der zweiten (und dritten) Generation“.[5]
Welche Auswirkungen diese Unschärfen haben, will ich am Beispiel zweier vergleichsweise aktueller Forschungsprojekte demonstrieren. Das eine von Wolf Rainer Leenen u.a. beschäftigte sich mit Trennungserfahrungen und den Folgen von „Familienfragmentierung“ bei türkischen Migranten der zweiten Generation.[6] Nach Feststellung dieser Forscher hat „fast jedes türkische Kind, das hier in der Bundesrepublik aufwächst, Zeiten der Trennung von einem Elternteil oder sogar beiden Eltern erlebt.“[7] Das heißt, die meisten mußten längere Zeiten allein oder nur mit einem Elternteil in der Türkei leben und wurden erst später nachgeholt.
Bei dem zweiten Projekt von Bernhard Nauck u.a. ging es um die Frage, wie die sozialen Netzwerke türkischer Migrantenfamilien Assimilierungsprozesse bei der Kindergenertion, also der zweiten Generation beeinflussen.[8] Für diese Forscher spielt das Thema Trennung und Nachzug keine große Rolle, denn: „67,6 Prozent der befragten Kinder wurden bereits in Deutschland geboren und nur 20 Prozent sind nach dem 8. Lebensjahr nach Deutschland eingereist.“[9] Tatsächlich meinen beide Forscherteams völlig unterschiedliche Personengruppen, wenn sie von der zweiten Generation sprechen. Die einen hatten Kinder der Kontraktarbeitergeneration interviewt, die es bis zum Universitätsstudium gebracht hatten — sie waren vom Jahrgang 1958 bis 1965. Das andere Team beschäftigte sich mit SchülerInnen der Geburtsjahrgänge 1976 bis 1980. Beide haben recht und beschreiben mit ihren Analysen einen wichtigen Ausschnitt der Realität von zweiter Generation, allerdings eben jeweils bloß einen Teil davon.
Es trifft durchaus zu, daß von der zweiten Generation viele den überwiegenden Teil, wenn nicht den ganzen Prozeß ihrer Sozialisation im bundesdeutschen Rahmen erfahren haben, daß sie Deutsch als Verkehrssprache des Alltags hinlänglich beherrschen, während sie die Türkei zumeist nur als Urlaubsland kennen. Für ebensoviele andere trifft dies alles jedoch nur bedingt zu. Auch das möchte ich an einem Beispiel illustrieren, nämlich anhand der Biographie eines in Istanbul geborenen Migranten zweiter Generation, der es in Hannover zu einiger Bekanntheit gebracht hat, da er bei der letzten Kommunalwahl ein Mandat im Stadtrat errungen hat. Seine Eltern waren KontraktarbeiterInnen der ersten Stunde, sie holten ihren Sohn nach, als er 7 Jahre alt war. Er ging hier bis zur 9. Klasse zur Schule, wurde dann jedoch nach Istanbul zurückgeschickt, wo er das Abitur machte. Anschließend kam er für ein Studium nach Deutschland zurück und ist seither geblieben. Seine Schwester jedoch, die die gleiche Migrationsstationen durchlebte, entschloß sich als 25jährige, endgültig zurück in die Türkei zu gehen. Sie hat also eine vierfache Migration hinter sich.
Der oben erwähnte race-relations-cycle — sofern er überhaupt auf europäische Verhältnisse übertragbar ist — bedarf somit einer sehr wichtigen Korrektur: Diese zweite Generation hat — obwohl sie nicht die Pionier-Generation ist — selbst intensive Erfahrungen mit dem Herkunftsland. Eine neuerliche Migration in die Türkei ist für sie eine offene Option. Gleichzeitig hat sie sich bereits einen substantiellen Bestand an Fertigkeiten in der hiesigen Gesellschaft — insbesondere die Sprache — angeeignet. In ihr vermischen sich also Eigenschaften, die sonst separaten Generationen zugeschrieben werden.
Es gibt daher heute eine gewaltige Palette von Möglichkeiten, wie die Eltern-Kind-Relation im Zuge einer Einwanderung aus der Türkei beschaffen sein kann: Auch heute noch gibt es Elternpaare, die so schlecht Deutsch sprechen, daß ihre Kinder für sie dolmetschen und bereits als Zwölfjährige Profis im Umgang mit Ausländerbehörden und deutschen Ärzten werden müssen. Andererseits gibt es auch türkischstämmige AkademikerInnen, die selbst hier zur Schule gegangen sind und ihre Kinder sehr bewußt zweisprachig erziehen. Und es gibt das ganze Spektrum an Grautönen dazwischen. Hier nun etwas Verbindliches über Prozesse intergenerationeller Traditionsbildung bei türkischstämmigen Migrantenfamilien schlechthin sagen zu wollen, wäre — zumindest für mich — eine gewagte Sache.
Ich will mich daher auf zwei sehr kontrastreiche Biographien aus unserem Projekt beschränken, in der Hoffnung, daß dabei vor allem die Widersprüchlichkeiten hervortreten. Die jüngeren der beiden, Fulya Korkmaz, (21 Jahre, arbeitslose Hauptschulabsolventin) wurde erst als 14jährige gegen ihren Willen nach Deutschland nachgeholt. Ihrer Wahrnehmung nach wurde sie praktisch zwangsdeportiert. Ihren Vater kannte sie nur aus den jährlichen Sommerbesuchen, denn er war schon vor ihrer Geburt als einer der letzten Kontraktarbeiter nach Deutschland geholt worden. Sie lebte in der Türkei mit ihrer Mutter, die ihr alles war, „Vater und Mutter — in eins“. Die erste Zeit hier war für sie ein Alptraum, ihr Pflichtschulbesuch wurde ein Fiasko, eine abgebrochene Lehre folgte, mit dem Vater gab es Autoritätskonflikte. Aus eigener Kraft heraus gelang ihr dann in einem zweiten Anlauf der Hauptschulabschluß, was angesichts ihrer zuvor schwachen Deutschkenntnisse sehr bemerkenswert ist. Gleichzeitig fand sie zum Islam, was sich auch im Tragen eines großformatigen Kopftuches ausdrückt. Zeitweilig war Frau Korkmaz versöhnt mit dem ungeliebten Leben in der BRD, zumal sich auch das Verhältnis zu ihren Eltern gänzlich verändert hatte.
War ihre Mutter in der Türkei noch die Allbeschützerin gewesen („Vater und Mutter — in eins“), ist es nun die Tochter, die auf die Mutter aufpaßt, denn diese findet sich mit dem Leben hier nicht zurecht. Als Analphabetin mit nur wenigen Brocken Deutschkenntnissen kann sie nicht einmal die Einkäufe für die Familie allein besorgen. Es ist ihre Tochter, die sie drängt, wenigstens einmal am Tag das Haus zu verlassen. Der Vater ist zwischenzeitlich berufsbedingt zum Invaliden geworden und sitzt ebenfalls den ganzen Tag zuhause. Vor dem Hintergrund ihres selbst errungenen Bildungserfolgs kann Frau Korkmaz heute gelassener mit den Autoritätsansprüchen des Vaters umgehen, der sich erst hier in der BRD mühsam das Lesen und Schreiben selbst beigebracht hat.
„Wenn ich irgendwas so mal sagen wollte, er hat gesagt, das wird nicht so gemacht. ... Und der hat gesagt, daß er immer so recht hat ... Also, ich hab' gesagt, das gibt es aber nicht, daß immer der recht hat. Das war für mich ganz schwer. Aber ... ich hab' das so später auch akzeptiert, weil der war so ein bißchen älter, weil der war auch nicht zur Schule gegangen hier, daher hab' ich gesagt, der weiß überhaupt nichts Ahnung. Ja, weil ... der ist ja auch nicht mal in der Türkei zur Schule gegangen. Der hatte gleich angefangen zum Arbeiten. Der wußte überhaupt nicht was... so ein richtige Seite ist oder eine falsche.“
Um nicht respektlos zu erscheinen, geben sie und ihre Geschwister dem Vater auch dann recht, wenn er auf einen offenkundigen Irrtum beharrt. Doch für ihr eigenes Handeln richtet sie sich nicht danach.
Zurück zum Thema intergenerationelle Tradierung: Man könnte das Kopftuchtragen dieser Frau als ein klares Bekenntnis zu den Werten und den religiös-kulturellen Traditionen ihrer Eltern interpretieren. Ich teile diese Einschätzung jedoch nicht, denn für mich signalisiert das Kopftuch vor allem Frau Korkmaz' Kampf um Selbstbehauptung in einer Gesellschaft, die ihr auf vielfältige Weise zu verstehen gibt, daß sie letztlich unerwünschte Bürgerin zweiter Klasse ist. Allerdings hat Frau Korkmaz bei ihrem Ringen um Selbstvergewisserung und Standortbestimmung mehr kulturelle Ressourcen zu Händen, als etwa ihren deutschen Schulkameradinnen zur Verfügung stehen, da sie zusätzlich auf die kulturellen Bestände der Herkunftsgesellschaft ihrer Eltern zurückgreifen kann. In ihrer völlig selbständigen Aneignung des Islams, eines der zentralen Element dieser Bestände, drückt sich aber zuletzt auch Distanz zu ihren Eltern aus, die den Islam eher als Konvention und Gewohnheit praktizieren.[10]
Nun zu der zweiten Interviewpartnerin, Leyla Sağlam[11] , eine berufstätige, ledige 27jährige Alevitin, die seit 1976 in Deutschland lebt. Ihr Vater kam im gleichen Jahr wie Frau Korkmaz' Vater mit den letzten Durchgängen des Anwerbeverfahrens kurz vor dem Anwerbestop nach Hannover. Damit enden aber auch schon die Gemeinsamkeiten, denn anders als die sechs Jahre jüngere Frau Korkmaz kannte Frau Sağlam ihren Vater und litt unter der mehrjährigen Trennung. Sie freute sich nicht nur darauf, wieder mit dem Vater zusammenleben zu dürfen, sondern träumte auch davon, dieses Schlaraffenland Deutschland endlich selbst zu sehen. Dieser Traum endete schnell, spätestens aber als sie und ihre Schwestern Prügel von den Nachbarkindern bezogen — einfach weil sie deren Sprache nicht verstanden. Sprachprobleme quälten Frau Sağlam auch in der Grundschule, doch kämpfte sie sich letztlich erfolgreich durch und erreichte den Realschulabschluß. Sie durchlief eine erste Ausbildung, sattelte beruflich noch einmal um, erwarb Zusatzqualifikationen und hat heute einen hochqualifizierten festen Arbeitsplatz bei einem renomierten Arbeitgeber, worauf sie sehr stolz ist. Frau Sağlams Integrationsgeschichte mutet wie aus dem Bilderbuch an: Ihr Freundeskreis ist weitgehend deutschsprachig, sie fühlt sich in Hannover heimisch und hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Nach Verständnisproblemen mit den Eltern gefragt, sagt sie:
„(stöhnt) Ooh. Ja. Doch. Je älter man wird als Frau, als türkische Frau, sowieso. Ich bin nun hier aufgewachsen, habe fast nur deutsche Freunde, und manchmal denke ich, ich bin ... teilweise Deutsche und dann irgendwann auch eine Türkin. Also ich muß mich umstellen, wirklich! ... Manchmal so zwei, ... zwei Ichs haben.“
In ihren jeweiligen Zugehörigkeiten differenziert Frau Sağlam sehr genau. In der Abgrenzung innerhalb des Freundeskreises gehört sie zu „den Türkinnen“, in der Abgrenzung von konservativen türkischen Wert- und Normvorstellungen ist sie eine Deutsche, innerhalb der Familie ist sie eine türkische Frau. Je älter sie jedoch wurde, desto mehr wuchs die Bedeutung einer weiteren Zugehörigkeit im Leben von Frau Sağlam: die Zugehörigkeit zur Gruppe der Aleviten. Konfrontationen mit den Vorurteilen sunnitischer Muslime gegenüber Aleviten machten ihr klar, daß sie innerhalb der türkischen Gruppe zu einer abgelehnten und diskriminierten Minderheit gehört. Tatsächlich kommt es bei Frau Sağlam zu einer Art ethnic revival: Sie engagiert sich heute in einem alevitischen Kulturverein.[12]
Vergleicht man nun die Lebensgeschichte der beiden Frauen und ihr jeweiliges Verhältnis zur Elterngeneration, so zeigen sich Gemeinsamkeiten und deutliche Unterschiede. Gemeinsam ist beiden, daß sie versuchen, das, was sie von der hiesigen Mehrheitsgesellschaft aufgenommen haben, positiv mit dem zu verbinden, was sie bereits aus der Türkei mitgebracht haben. Beide haben auch Lust an der Rolle der Vermittlerin. Frau Korkmaz berichtete beispielsweise, daß sie ihre deutschsprachigen Freundinnen am liebsten in türkische Läden mitnimmt, während sie ihre türkischsprachigen Freundinnen mit Vorliebe in deutschen Cafés trifft — bewußt mit dem Ziel, einen Austausch zu organisieren. Beide integrieren jedoch auf unterschiedliche Weise die Werte, Traditionen und Normen der Eltern in ihren Lebensentwurf. Für Frau Sağlam ist die Wiederentdeckung ihrer alevitischen Religion auch eine Wiederannäherung an ihre Eltern, mit denen sie erhebliche Konflikte ausgetragen hat, im Ringen darum, genauso leben zu dürfen wie ihre deutschen Freundinnen. Ausdrücklich betont Frau Sağlam, daß in Sachen Relgion ihre Mutter ihr Vorbild sei und daß sie ihre Kinder einmal ganz genau so zu alevitischen Glauben führen wolle, wie ihre Mutter es bei ihr getan hat. Für Frau Korkmaz' Eltern hingegen ist der muslimische Glaube mehr eine habituelle Selbstverständlichkeit gewesen, die pointierte und expressive Gläubigkeit der Tochter, die ihr große berufliche Nachteile eintrug, entfernt sie eher von einander. Auch auf die Gefahr hin, um der Zuspitzung willen zu übertreiben, behaupte ich, daß die in ihrem äußeren Erscheinungsbild als kopftuchtragende Muslimin so traditionell und konservativ (im Sinne von „das Bestehende bewahrend“) wirkende Frau Korkmaz sich in ihrer Auseinandersetzung mit der hiesigen Gesellschaft stärker vom kulturellen Horizont ihrer Eltern verabschiedet hat als die auf den ersten Blick fast komplett „eingedeutschte“ Frau Sağlam.
Allerdings darf dieses Paradoxon nicht überinterpretiert werden. Die zunächst so unterschiedlichen Entwicklungswege beider Frauen haben einen gemeinsamen Hintergrund darin, daß die aus der Herkunftsgesellschaft mitgebrachten kulturellen Wissensbestände im Laufe des Etablierungsprozesses einer Einwanderungsgruppe notwendige Wandlungen und Adaptionen an die neue Lebenssituation erfahren. Für die alevitische Teilgruppe der Einwanderer aus der Türkei etwa brachte die Erfahrung der Migration einen beispiellosen Emanzipationsprozeß: Erst unter den Bedingungen der Religionsfreiheit in der BRD entwickelten sie sich ganz allmählich zu einer religiösen Gruppe im eigentlichen Sinne. Aus dem nur im Verborgenen praktizierten, ausschließlich von Mund zu Mund überlieferten, völlig heterogenen Glauben beginnt sich gegenwärtig eine kodifizierte Religion zu formen, was seinerseits Rückwirkungen auf die Aleviten in der Türkei hat. Dieser Prozeß verläuft generationenübergreifend — Frau Sağlams Eltern beispielsweise gehören demselben Kulturverein an wie ihre Tochter. Für die sunnitische Mehrheitsgruppe unter den Einwanderern aus der Türkei hingegen hatte die Migration zumeist andere Auswirkungen. Zwar veränderte sich auch ihr Verhältnis zum Glauben notwendigerweise in einer kulturell christlich geprägten Umwelt, die keinerlei Rücksicht auf die Gebot des Islam nimmt. Doch nahm dieser Prozeß unter den Sunniten, wie etwa die Studien von Werner Schiffauer[13] gezeigt haben, eher die Form einer Individualisierung des Glaubens an und eignet sich daher weniger als generationenverbindendes Moment.
Stellt man sich abschließend die Frage, wie denn nun kulturelle Ressourcen in Migrantenfamilien tradiert und/oder transformiert werden, ergeben meine — zugegebenermaßen sehr skizzenhafte — Darlegungen ein uneinheitliches Bild. Weder die schematische Doktrin des US-amerikanischen race-relations-circle noch das abgedroschene Klischee vom zwischen zwei Kulturen zerrissenen Migrantenkind helfen hier weiter. Offenkundig scheint mir nur eines: Wenn eine Tradierung von kulturellen Beständen zwischen den Generationen stattfindet, dann erfolgt sie niemals eins zu eins — schon gar nicht unter den Bedingungen der Migration. Die Aneignung durch die nachfolgende Generation geschieht selbständig und angeleitet von ihrer Bedürfnis- und Interessenlage, selbst wenn das Ergebnis von außen gesehen als bloße Kopie erscheint. So betrachtet möchte ich meinen Beitrag als eine Aufforderung zum genauen Hinschauen verstanden wissen.
veröffentlicht in:
Fechler, Bernd; Kößler, Gottfried; Lieberz-Groß, Till (Hg.)
»Erziehung nach Auschwitz« in der multikulturellen Gesellschaft.
Pädagogische und soziologische Annäherungen
Weinheim u.a. 2000 S.59-66
Fußnoten: